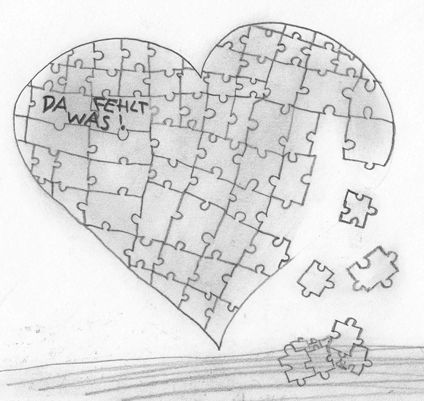 Pfarrnetzwerk
Asyl
Pfarrnetzwerk
Asyl
„Wenn bei dir ein Fremder in eurem Land lebt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten, und du sollst ihn lieben wie dich selbst; denn ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott.“ (Lev 19, 33-34)
__________________________________________________________________________________________________________
=> HOME
Fluchtgeschichten
Mein Vater wurde im Jahre 1919 als jüngstes von sechs Kindern
in Bratislava geboren. Die Familie hatte wohl deutsche Wurzeln.
Gegen Ende des 2. Waltkrieges wurde mein Vater zur Deutschen
Wehrmacht eingezogen. Er kam nach Russland bis in den Kaukasus.
Nach dem Zusammenbruch der Front im Jahre 1945, ging er „von
Russland zu Fuß nach Hause“, wie er immer zu erzählen pflegte.
In Bratislava fand er seine Familie nicht mehr – sie war in der
Zwischenzeit vertrieben worden. Er geriet in russische
Kriegsgefangenschaft, kam nach einem Jahr aber wieder frei,
weil er sich als Tscheche ausgegeben hatte.
Alle Personaldokumente meines Vaters waren verlorengegangen. Er
ging über die österreichische Grenze, meldete sich bei der
Polizei und erklärte eidesstattlich seine Identität. Eine Tante,
die in Wien lebte, nahm ihn in ihre Wohnung auf. Er bekam eine
Aufenthaltsbewilligung, weil er sich verpflichtete, beim
Wiederaufbau als Hilfsarbeiter mitzuarbeiten Die „Verleihung der
Österreichischen Staatsbürgerschaft“ und ein österreichischer
Reisepass waren zeitlebens die einzigen Personaldokumente.
Im Flüchtlingslager in Hainburg fand er seine Familie wieder.
Seine Eltern und der Großteil seiner Geschwister gingen von dort
aus nach Deutschlang lebten bzw. leben hier. Mein Vater ist
als einziger aus seiner Familie in Wien geblieben.
Immer, wenn ich die folgende Bibelstelle höre, muß ich an
meinen Vater denken:
„Mein Vater war ein heimatloser Aramäer. Er zog nach
Ägypten, lebte dort als Fremder mit wenigen Leuten und wurde dort
zu einem großen, mächtigen und zahlreichen Volk.“ (Dtn. 26,5)
Mein Vater war einer jener vielen Menschen, die im Krieg ihre
Heimat verloren haben. Er hat darunter gelitten „a displaced
person“ zu sein. Das war seine seelische Kriegsverletzung.
Doch weil er ist in seiner neuen Heimat bleiben konnte,
hat er „Fuß gefasst“ – „Wurzeln geschlagen“ – „Spuren
hinterlassen“. Seine Urenkel leben in diesem Land.
„Denn ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe“ - Spruch
des Herrn – „Pläne des Heils und nicht des Unheils; denn ich will
euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben.“ (Jer
29,11)
Meinem Vater zum Andenken.
XXs Vater stammt aus Poku, das im
Norden Ghanas liegt an der Grenze zu Burkina Faso. Er gehörte dem
Busanga-Stamm an. Seine Mutter kommt auch aus Poku, gehörte aber
dem Kusasi-Stamm an. Beide Stämme sprechen verschiedene Sprachen.
Krieg als latente Gefahr
In Poku gibt es aufgrund der
Landbesitzungen seit Jahrzehnten Streit zwischen dem
Kusasi-Stamm und dem Mamprusi–Stamm. Oft kommt es wegen
Kleinigkeiten zu großen Auseinandersetzungen zwischen den Stämmen,
es herrscht dann regelrecht Krieg mit Toten und Verletzten. Um
diesen „Unannehmlichkeiten“ auszuweichen, die bis heute noch da
sind, haben sich seine Eltern in der Kumasi/Ashanti-Region
niedergelassen. Dort erwarben sie drei Zimmer, in denen XXs
Geschwister bis heute leben.
XX ist als erstes Kind in Kumasi
geboren. Es folgten noch zwei Brüder und eine Schwester, die heute
acht Jahre alt ist. Die Eltern pachteten ein Stück Land bei
Kintampo, das vier Stunden Autofahrt von Kumasi entfernt war. Sie
nutzten das Land für den Anbau von landwirtschaftlichen Produkten
und für Viehzucht. So waren die Eltern viel unterwegs und wohnten
auch oft dort.
Tod auf der Straße
Betroffen erzählte mir XX, dass seine
Eltern - als er gerade vierzehn Jahre alt war - einen Autounfall
mit tödlichem Ausgang hatten. Unverständlicherweise hat diese
traurige Nachricht XX nicht rechtzeitig erreicht und er
konnte bei der Beerdigung nicht dabei sein. Die Sorge für seine
jüngeren Geschwister fiel ab diesem Zeitpunkt auf seine Schultern
und da kein Geld mehr da war, musste er die Schule (Senior
secondary school) abbrechen. Es gelang ihm durch
Gelegenheitsarbeiten für das Weiterkommen der Familie zu sorgen.
Aufbruch in eine ungewisse Zukunft
XX hatte Kontakt zu einem Freund in
Libyen, der ihn einlud zu ihm zu kommen um Geld zu verdienen. Die
Reise dorthin war kein leichtes Unternehmen: auch sie kostete
Geld. Durch den Verkauf persönlicher Gegenstände und die Hilfe
durch Freunde konnte er mit sechs Millionen Cedis (das waren
umgerechnet etwa 450 Dollar und entsprach in Ghana dem
Jahreslohn eines einfachen Arbeiters) im Jahr 2009 aufbrechen: ein
Lastkraftwagenfahrer, der Sperrplatten nach Niger transportierte,
nahm ihn mit. Die Reise ging von Kumasi zunächst nach Burkina Faso
und von dort durch den riesigen Nachbarstaat Niger.
XX, der offizielle Beifahrer
Unter der Bezeichnung „Beifahrer“
kam XX, der keine Dokumente besaß, durch alle Grenzkontrollen. Der
LKW-Fahrer hatte wohl Leute in Niger darüber informiert, dass sein
Begleiter Geld bei sich hat. In der Folge wurde XX ausgeraubt und
dann mit anderen Einwanderern in einem Autobus nach Agadas – einem
Aufenthaltslager – gebracht. Dort hatte er die Möglichkeit durch
Schwerarbeit Geld für die Weiterreise zu verdienen. Sobald er den
für die Weiterreise benötigten Geldbetrag erarbeitet hatte, fuhr
XX mit einem Truck nach Druku. Das war eine Dreitagereise, um dann
mit einem anderen Fahrzeug, einem Pickup, die Wüste, Richtung
Libyen, zu durchqueren.
In der Wüste überfallen und verirrt
Diese Reise dauerte für ihn drei
Wochen. Es war eine beschwerliche Fahrt unter glühender Sonne,
viel Staub, Sand und unvorstellbarem Straßenzustand. Die Nächte
können in der Wüste auch sehr kalt sein. Das Fahrzeug war von
Passagieren überlastet und der Essensvorrat bestand aus Wasser und
Gari (Cassavamehl).
Auf halben Weg wurden sie von einer mit
Gewehren bewaffneten Räuberbande aus dem Tschad aufgehalten und
ausgeraubt. Alle Reisenden mussten sich nackt ausziehen, wurden
geschlagen, verwundet und mussten Abführmittel in Pulverform
einnehmen um sicher zu sein, dass sie nichts versteckten. Auch
hier wurde XX seines gesamten Geldes beraubt.
Der Fahrer brachte dann alle zu einer
Wasserquelle um sich zu reinigen und die Verletzungen zu lindern.
Die Reise ging schließlich weiter und es stellte sich heraus, dass
der Chauffeur die Fahrrichtung nach Libyen verloren hatte. Die
Irrfahrt dauerte drei Tage. Wiederum wurden sie von einer
Räuberbande überfallen. In der nächsten Nacht begegneten sie
Menschen, die ihnen die Richtung nach Libyen zeigten, wo sie dann
nach drei Tagen in Gabha ankamen.
Verkauft wie ein Stück Vieh
XX und die Mitreisenden wurden vom
Fahrer an die Leute in Libyen verkauft und in ein Lager gebracht,
wo sie misshandelt wurden. Die Polizei brachte sie nach Tripolis,
wo sie wiederum illegal verkauft wurden, da sie kein Geld bei sich
hatten. Für diese Herren mussten sie sechs Monate Schwerarbeit
leisten. Nachher bekam er einen gefälschten Pass und konnte als
Maurer bei in einer Firma arbeiten. In Tripolis begegnete er auch
seinem Freund, der nicht in der Lage war ihm in irgendeiner Weise
behilflich zu sein.
Zu allem Überfluss: Kriegsausbruch
Im Dezember 2010 brach der Bürgerkrieg
aus. Es bestand Ausgangssperre: wer sie nicht befolgte und
trotzdem das Haus verließ, kehrte nicht mehr zurück. Speisen waren
nicht zu haben. Alle wollten nur Geld haben.
Ein Mann in Militärkleidung kam am
10.05.2011 um 01.30 nachts zu ihm und brachte ihn im Auto zu einem
Boot ans Meer. Nach einer Reise von drei Tagen ohne Nahrungs- und
Flüssigkeitsaufnahme erreichten sie Lampedusa. XX fühlte sich
erschöpft und niedergeschlagen, auch weil er nicht wusste, was mit
ihm geschah und noch geschehen wird.
Im Lager waren Menschen von
verschiedenen Nationen und Sprachen, nach zwei Tagen wurden sie
wiederum zu einem Schiff mit unbekanntem Bestimmungsort gebracht.
Am 19. Mai 2011 verließ er in Genua das Schiff und wurde in einem
Bus nach Bozen gebracht. Seit dem 14. November 2011 ist er im
Fischerhaus in Vintl (Pustertal) in Erwartung der
Aufenthaltsbewilligung.
Und nun, wie sollte es weitergehen?
XX arbeitet zur Zeit einige Stunden
täglich im Haus der Solidarität. Er ist dankbar und froh für diese
Möglichkeit, für das Verständnis und Einfühlungsvermögen, die sie
ihm dort entgegenbringen. Er fühlt sich angenommen in seinem
schweren Schicksal, er, der sich so oft zwischen Leben und Tod
befunden hat.
Die Hoffnung stirbt zuletzt
XX hofft sehr, eine
Aufenthaltsbewilligung und Arbeit zu bekommen, damit er seinen
jüngeren Geschwistern in Lebensunterhalt und Schulbildung
beistehen kann. Wenn XX an seine Vergangenheit denkt,
überkommt ihn eine große Traurigkeit und zugleich eine
Empfehlung an seine Mitbürger in Ghana und in anderen Ländern,
niemals in ihrem Leben die Heimat zu verlassen um einer
solchen Ungewissheit entgegenzugehen. XX sagt:„Nur Gott hat
mich gerettet!“ (2012)
„Noch in Erinnerung“
Am 3.Juli 1945 vor Sonnenaufgang
sperrten tschechoslowakische Soldaten die vorrangige
Dorfstraße von Bruck a.d. Donau beim Ein- und Ausgang ab.
Bewohner des Dorfes, die zum
Schnitt auf das Feld wollten, wurden mit Worten
zurückgeschickt: „Drehts um, ihr braucht nicht mehr arbeiten,
ihr werdet hinaus gschmissen“. Diese „Mär“ verbreitete sich in
Windeseile.
Mein „Lieblingsonkel“ Josef, der
jüngste Bruder meiner Mutter, er wohnte vier Häuser von uns
entfernt kam etwas aufgeregt zu meinem Vater und sagte ihm:
„Ich fahre noch etwas weg zu den
Slowaken, wo ich Slowakisch gelernt habe; ich möchte gerne
euer besseres Ross mit meinem zusammen spannen, damit ich
schneller vorankomme“. Mein Vater willigte ein, er nahm auch
von uns etwas mit. Ich erinnere mich, dass die große
Regen-Plane für unsere Dreschmaschine auch aufgeladen wurde.
Woran dachte da mein Vater? Ich habe ihn später leider nicht
befragt. Spontan sagte ich „ ich möchte mit Josef Onkel
mitfahren“.
Dazu muss ich sagen, dass ich sehr
oft mit ihm unterwegs war. Und so fuhren wir quer zur
Hauptstraße über Felder in das slowakische Nachbardorf. Wir
luden die Sachen schnell ab und machten uns auf den Rückweg.
Wir mussten wieder die Kleine Donau mit einer Fähre
überqueren, die der Josef Onkel bediente. Ich hielt die Zügel
der Pferde. Am Ufer kam uns eine Frau entgegen, es war eine
slowakische Händlerin. Mein Onkel erkundigte sich, was in
unserem Dorf los ist. Sie fing heftig zu weinen an und sagte:
„Die Brucker sind schon alle hinaus gschmissen worden.“ Mein
Onkel und ich waren natürlich sehr betroffen und umso
schneller versuchten wir heim zukommen.
Wir fuhren von hinten in seinen
Garten.
Auf der Vorderseite war eine
Holzplanke. Ich sprang gleich vom Wagen und schaute durch die
Fugen hindurch auf die Straße. Was sah ich da? Mein Jokl
Onkel, mein Firmpate, fuhr mit seinem Pferdewagen, begleitet
von einem Soldaten; darauf seine Frau mit dem 1 jährigen Sohn.
Wie ich nachher erfahren habe, war das eine Ausnahme, dass
jemand einspannen durfte.
Aber da hatte ein „Aussischmeisser“
Nachsicht.
Ich rief meinem Josef Onkel zu „Den
Jokl führen sie schon weg“. Ich wollte nur heim. Er: „ Bleib
da“. Ich aber wartete nur ab, dass der Pferdewagen vom Joklo
Onkel vorbei war, huschte hinaus und bog links ab und war
schon hinten bei unseren Hausgarten. Wir hatten noch ein wenig
altes Stroh, indem das neue Fahrrad meiner Mutter versteckt
war. Aber das Stroh war durcheinander und das Fahrrad war
natürlich weg. Ich ging weiter nach vor. Im Freien lag
friedlich das Vieh, mit dem ich am Vortag noch der Weide war.
Dieses Bild von dem ruhenden Vieh sehe ich heute noch vor
mir... Ein Soldat entschwand gerade zum Nachbarhaus, unterm
Arm einige Wäschestücke. Nun kam ich zu unserem Wohngebäude.
Zu! Verschlossen! Kein Vater, keine Mutter mehr da! Sie waren
bereits „hinausgeschmissen“ worden. Zur Illustration,
was das bedeutet hat: Die Bewohner hatten ja keine Koffer oder
sonstige „Gefäße“ fürs Packen. Meine Eltern hatten ein Tuch
mit vier Bändern („Zizeltuch“), womit sonst Heu oder anderes
Futter transportiert wurde, ausgebreitet und ein paar
„Armseligkeiten“ verstaut.
Dazu kam: meine Mutter war
hochschwanger (sie hat am 29. Juli in Hainburg Klara
entbunden), meine Schwester war 7 Jahre und ich mit 10 Jahren
hätte „ das Kraut auch nicht mehr fett“ machen können. Mit
einer solchen Gegebenheit mussten sie handeln ...Ich stand
also vor verschlossenen Türen. Ich ging ins Nachbarhaus – auch
niemand da. Ins nächste – da gab es einen Knecht, einen
Slowaken. Den fragte ich. Er meinte: „die sind beim Notar“.
Das war am Anfang der Ortschaft. Unser Haus befand sich in der
Mitte, der Schule gegenüber. Und so machte ich mich auf den
Weg, mitten auf der Straße. Siehe da! Ein Soldat fuhr vergnügt
mit dem Fahrrad meiner Mutter. Ich rief ihm zwar zu „Das ist
unser Rad, gib es zurück“!. Er schenkte mir keine
Aufmerksamkeit, er verstand mich ja auch nicht. So ging ich
enttäuscht weiter, ich hatte ständig Tränen in den Augen. Und
bevor ich zum Ziel kam, sah mich ein Schulfreund meines Vaters
so weinend allein auf der Straße. Er sprach mich an „Von wo
kommst du daher“, und lud mich ins Haus. Ich erzählte, dass
ich mit meinem Josef Onkel bei den Slowaken in Ivanka war.
Seine Frau hatte inzwischen einen Teller Kaiserschmarrn
hergerichtet. Aber der war so heiß, so dass ich keine Geduld
aufbrchte, ihn fertig zu essen. Ich wollte nur zu meinen
Eltern. Ja die waren fast visá-vis im Hof vom Notarhaus.
Schnell schlüpfte ich durch den schmalen Eingang. Es war ein
aufregendes Wiedersehen. Endlich waren wir zusammen. Nach
einiger Zeit machte ich mich wieder auf den Weg. Meine Mutter
erklärte mir, dass in der hinteren Kammer unsere Schuhe seien.
Ich soll sie holen. Die Bewacher konnten die Kinder nur schwer
unter Kontrolle halten.
Mir gelang es, zu entwischen und
einige Paar Schuhe zu holen.
Gegen Abend wurde gefragt, wer zu
Hause Pferde habe. Mein Vater meldete sich. Ja die sollten sie
mit dem entsprechenden Fuhrwerk herbeibringen Da ging ich auch
mit meinem Vater mit. Zu Haus angekommen sind wir durch ein
Fenster eingestiegen und hatten noch Bettzeug herausgeholt,
das wir unter den Sitz versteckten.
An den beiden Sammelplätzen – der
andere war bei der Kirche – wurden die Vertriebenen noch beim
Durchlass „gefilzt“, d.h. Was den „Akteuren“ gefallen hatte,
haben sie noch weggenommen. Als wir in Kolonne
zusammengestellt waren, fuhren auf der anderen Straßenseite
einige zukünftige Bewohner auf leere Leiterwägen ins Dorf.
Junge Männer sprangen herunter und
kamen auf uns zu. Anscheinend wussten sie schon, welches Haus
sie bekommen. Denn einer kam zu unserem Wagen, er wusste die
Nummer unseres Hauses, denn er nahm meinem Vater die Zügel weg
und sagte: „Die gehören jetzt mir“. Mein Vater musste den
Platz räumen. Der junge Bursch hat dann die Zügel der Pferde
genommen. Meine Mutter auf der Sitzbank daneben musste sich
damit abfinden. Der Zug setzte sich in Bewegung und so wurden
wir dann „abgeführt“ nach Preßburg durch die Nacht hindurch in
eine aufgelassene Patron-Fabrik. Auf den Fußboden mit ein
wenig Stroh verbrachten wir dort 3 Wochen. Das war bestimmt
die schlimmste Zeit für uns. Die Männer wurden geholt, um
Schutt in der Stadt wegzuräumen. Kleine Kinder starben, alte
Leute hatten es besonders schwer. Die Sanitäranlagen waren
einfach schrecklich . Ansteckende Krankheiten breiteten sich
aus. So weit es möglich war, versuchten wir dieser Misere zu
entkommen.
Ich hatte in dieser Zeit auch
wieder Glück. Meinem Vater und mir gelang es das Lager zu
verlassen. Ein Bruder meines Vaters hatte in ein ungarisches
Nachbardorf geheiratet und war ein gut situierter Bauer. Bei
ihm verbrachte ich einige Zeit und hütete zusammen mit
ungarischen Buben sein Vieh. „Leider“ verständigte ich mich
mit ihm auf Deutsch, so dass ich nicht viel Ungarisch lernte.
Aber es war trotzdem sehr spannend. Mein Steffl Onkel lieferte
auch öfters Gulasch in großen Behältern
ins Lager nach Pressburg. So zeigte
er seine Verbundenheit mit seinem Geburtsort.
Die Lagerleute dankten es ihm.
Ich weiß nicht, wo mein Vater
erfahren hatte, dass wir nach Österreich abgeschoben werden.
Auf alle Fälle holte er mich wieder ab. Er konnte einen
Freund, dem er einmal in einer Mühle geholfen hatte, sogar
gewonnen, - auch wegen meiner hochschwangeren Mutter - dass er
uns zur Grenze mit seinem Pferdewagen fuhr. Ja wir kamen am
24. Juli abends an die Grenze und übernachteten im Freien. Am
anderen Tag haben „sie“ uns über die Grenze geschickt.
Das war der alte Grenzübergang
direkt vor Kittsee. Da hat es geheißen „Jetzt könnt ihr
gehen“! Ja wir gingen. Eine Gruppe bog „links“ ab nach Pama,
ein Ort, mit dem Brucker einmal Viehhandel getrieben hatten
und Bekanntschaften bestanden.
Eine Gruppe ging „gerade“ nach
Berg, Edelstal und „wir“ bogen nach „rechts“ und kamen nach
Wolfsthal. Dort wurden uns die Stallungen des Grafen zu
gewiesen.
Vieh war ja keines mehr da. Das
hatten die „Deutschen“ beim Rückzug mitgenommen und den Rest
holten die „Russen“. So hatten wir Platz. Aber welch ein
Geruch im Sommer!? Vor Hunger aßen wir die „grünen“ Äpfel des
Grafen. Mein Vater organisierte bald eine Kammer vielleicht
4x7 in einem Meierhof, zwischen Wolfsthal und Hainburg. Dort
zogen mein Jokl Onkel zu dritt und wir, nachdem meine Mutter
in Hainburg unsere Klara zur Welt brachte, zu fünft ein.
Leider waren wir nicht allein. Eine
übergroße Schar von unzähligen Flöhen war schon vor uns da und
behaupteten sich ganz einfach. Am meisten litt mein Vater. Den
haben sie unheimlich gern gehabt. Meine Schwester Julie ging
im September nach Hainburg in die Schule. Ich brauchte nicht,
denn ich konnte ja schon lesen und schreiben. Nein - es gab
einen anderen Grund - eine „Mär“: „Wir kommen wieder heim. Die
werden nur alles ausrauben, aber aufbauen können wir es
wieder.“
Diese Mär hat sich einige Zeit
gehalten. Darum bin ich lieber mit meinem Vater mitgegangen,
wenn er bei den Russen bei Viehschlachten war. Die Zubusse an
übriggebliebenen Fleischstücken besserte den Speiseplan unser
beider Familien auf.
Öfters sind wir in die alte Heimat
mit russischen Lastwagen unterwegs gewesen (oder gingen
schwarz durch die „Bätschen“ (ein Wald) Da holten wir auch
Lebensmittel: Mehl, Schmalz, Milch,... Das spannendste
Unternehmen war wohl – wir brauchten einen Kinderwagen für
unsere kleine Klara.
Darum ging es wieder in die alte
Heimat nach Preßburg auf einen russischen Laster, der
Schlachtvieh geladen hatte und das meinem Vater und mir
Deckung bot. So kamen wir durch die Grenze. In Preßburg gab es
zum Unterschied von Österreich noch vieles zu kaufen. Wir
hatten noch slowakische Kronen und so kauften wir einen neuen
Kinderwagen. Zurück war es ein wenig komplizierter; ich musste
den Kinderwagen auf einer „Pontonbrücke“(deutsche Soldaten
hatten beim Rückzug die Brücken gesprengt) durch eine
„Vorkontrolle“ über die Donau ans andere Ufer bringen; mich
als Kind kontrollierte niemand. Mein Vater setzte auf einen
russischen Laster über.
Dann wieder Bestechung mit
Zigaretten und schon waren wir auf einen Lastwagen und wir
waren durch die Grenze.Entgegenkommend führte uns der Russe
bis zur Haustüre. Da mein Vater slowakisch sprach, gelang es
ihm immer wieder, sich mit den russischen Soldaten zu
verständigen. In Preßburg habe ich mit meinem Vater kaum
gesprochen, da es sehr gefährlich war deutsch zu sprechen
.Dafür konnte man eingesperrt werden.
Gegen Ende Oktober organisierten 2
Schulfreunde von meinem Vater einen Traktor, mit dem wir – 3
Familien - auf dem Anhänger die Reise nach Wien antraten. Ach
wie war ich von Wien enttäuscht! Alles war zerstört durch die
Kriegsereignisse: Bombenruinen, Einschüsse,...Wir fuhren die
Simmeringer-Hauptstraße bis zur Rennwegkaserne und bogen
rechts ab in die Schlachthausgasse 19, wo einige Baracken
standen. Wir - 3 Familien- fanden gemeinsam in einem größerem
Raum notdürftig Unterkunft. Bald wurde eine andere Baracke,
die desolat war, zerlegt und mit den Elementen wurden Wände
aufgestellt, sodass die einzelnen Familien einen
abgeschlossenen Raum bekamen. Für uns Kinder war das
Lagerleben sehr lustig; es gab ein großes Areal, wo wir uns
treffen konnten, „verbanne dich“,“verstecken“ spielen... Es
war uns nie fad, denn es war immer etwas los. Dazu kamen die
vielen Möglichkeiten und Begegnungen im „Sale“- Kinder und
Jugendzentrum der Salesianer Don Boscos, wo wir „Flüchtlinge“
- Kinder UND Erwachsene – mit Wohlwollen aufgenommen wurden
und uns bald zu Hause fühlten.
Mit dem möchte ich schließen, denn
es begann ein „normales“ Leben in Wien – ich ging nach einem
Jahr (unsere Schule hatte die SS im November 44 besetzt)
wieder in die 4.KlasseVolksschule.
Die Vertreibung war für viele ein
Ein- und Abbruch mit vielen Verwundungen und Schmerzen und
großem Leid – eine Katastrophe. Davon waren vor allem die
Kleinkinder und die alten Menschen betroffen. Für mich war es
wie ein Abenteuer mit vielen Erlebnissen und Eindrücken, die
mein Leben prägten. Sie eröffnete mir auch einen Lebensweg,
den ich zu Hause nicht gehabt hätte.
Und es begab sich…
… und er zog weiter, weil in den
Herbergen kein Platz für ihn war.
Ein Auszug aus der
Weihnachtsgeschichte? Leider nein.
An einem Donnerstag Nachmittag ,
Ende Oktober, kann ein Mann in die Pfarrkanzlei und fragte, ob
ich ihm helfen könne. Er sei obdachlos und bräuchte, wegen der
Kälte, einen Schlafplatz in einem der Quartiere, welche für
Menschen, die auf der Straße leben, zur Verfügung stehen. Er
hätte schon einige Nächte in diesen Häusern verbracht, aber
jetzt seien alle voll. Meine Anrufe bei den verschiedensten
Institutionen bestätigten diese Aussage. Und von offizieller
Seite erfuhr ich: „Wir wissen um diese Situation. Leider sind
alle Häuser
voll. Aber am Montag der nächsten
Woche wird ein neues Büro, eine neue Anlaufstelle eröffnet.
Dort soll er sich dann möglichst schon in der Früh melden,
weil da die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass er einen Platz
bekommt.“ Mehr könne sie im Moment nicht für ihn tun.
Hmm, also eine Möglichkeit auf
einen Platz. Und wenn’s nicht klappt? Leider konnte auch ich
nicht mehr erreichen und musste ihm für die nächsten 4 Tage
sich selbst überlassen. 4 Tage im Freien bei recht kaltem
Wetter. Ein Umstand, der mich noch lange beschäftigte.
Die Weihnachtsgeschichte fand ein
gutes Ende und wurde weltweit zur wohl größten Feier des
Jahres.
Was aus dem Obdachlosen wurde?
Keine Ahnung.
Lassen wir auch heuer das Fest von
der Geburt Jesu zu einem Fest der (Nächsten-)Liebe und der
menschlichen Wärme werden. Und stellen wir die Menschen in die
Mitte, nicht die Geschenke.
In diesem Sinne wünsche auch ich
Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest!
Am 15.Januar 1945 wurden wir ausgebombt und von da an lebten
wir im Keller. Am Anfang der Praterstraße war sozusagen die
Hauptkampflinie, die sich dem Kai entlangzog und uns zwang, auf
dem Boden liegend die Zeit zu verbringen. Nur in den Kampfpausen
wurde uns gestattet, den Keller zu verlassen und in der Waschküche
zu essen und das Gegenteil zu tun.
Nach dem Waffenstillstand oder Kriegsende, ich kann mich da
nicht so genau erinnern, ich war 9 Jahre alt, bekamen wir bei
einer Frau im Nachbarhaus ein Zimmer zur Untermiete. Ohne Gas und
Strom nur für 2 Stunden, in denen meine Mutter die Erbsen und ein
paar Käfer kochte. Endlich um 22 Uhr schlangen wir heißhungrig
diese üble Speise hinunter, aber was tut man nicht alles aus
Hunger.
Inzwischen zwangen die Besatzer, die Erwachsenen die Leichen
und Leichenteile auf Schubkarren in den Augarten zu bringen,
wo sie in die Bombentrichter geleert wurden und dann die Panzer
das Erdreich wieder darauf schoben. Meine Mutter ließ mich
natürlich nicht allein zu Hause und so kann ich mich daran noch
sehr gut erinnern
Die Brücken über den Donaukanal waren gesprengt, Die
abgebrochenen Fahrbahnen hingen ins Wasser und wurden mit ein paar
Planken überbrückt. Wir mussten aber hinüber, denn bei uns waren
die Wasserrohre zerborsten, und wir gingen in das Haus, wo heute
die Kammerspiele sind, um uns mit Wasserkannen das kostbare Nass
zu holen.
Meine Lieblingspuppe war mit mir im Luftschutzkeller
gewesen, und das war das einzige, was meine Mutter zum Verhamstern
hatte, für ein Kilo Mehl und zwei Eier.
Im September war es dann soweit, vor Hunger konnten wir kaum
mehr schlafen, und so entschloss sich meine Mutter, mit mir in die
Oststeiermark zu flüchten.
Der erste Tag war noch halbwegs gut, bis Wiener Neustadt
ging ein Zug, dann war es aus. Am späten Nachmittag standen wir
zwischen Glasscherben und Russen auf dem Bahnhof. Ein Engel in
Gestalt einer lieben Frau nahm uns mit und brachte uns zu ihrer
Freundin, der Apothekerin und wir durften im Geschäftslokal
übernachten.
Am nächsten Tag nahm uns eine Fuhrwerk bis Aspang mit und
dann ging es bergauf, zu Fuß natürlich. Bei einem
Bahnwärterhäuschen stand eine Frau mit drei Kindern und erbarmte
sich meiner und schenkte mir ein Häferl Milch. Inzwischen zogen
Gewitter auf und ich musste mich in mein rotes Regencape hüllen,
für illegalen Grenzübertritt nicht gerade die richtige Garderobe.
Daher war es nicht verwunderlich, dass uns ein plötzliches STOJ
zur Salzsäule erstarren ließ. Zwei Russen kontrollierten Mamas
Rucksack auf Waffen, ließen uns aber weiter gehen. Bei einem
Wolkenbruch erreichten wir am Hochwechsel einen Bauernhof, wo
meine Mutter fragte, ob wir im Heustadel übernachten dürften. Die
Hunde wurden auf uns losgelassen und wir gaben natürlich
Fersengeld. Um ca. 22 Uhr waren wir endlich in Friedberg und im
Kaufhaus Muhr bekamen wir etwas zu essen und ein Bett, das uns die
Lehrlinge gutherzig überließen. Nach dem Frühstück bekamen wir den
Rat, bei der englischen Kommandantur nachzufragen, ob uns ein
Militärfahrzeug bis Hartberg mitnehmen würde. Der diensthabende
Offizier hatte für uns nichts übrig, und wollte uns sofort wieder
nach Niederösterreich abschieben, ließ es dann aber sein, nachdem
sich meine Mutter vor ihm auf die Knie geworfen hatte.
So ging es nun zu Fuß weiter, bis in die Nähe von Hartberg.
Dort durften wir in einer Kammer eines Bauernhofes das Bett
benützen. Nach Begutachtung des Bettzeugs, das nur so von Wanzen
wimmelte, schliefen wir auf dem Boden und waren trotzdem am
nächsten Tag wieder fit, weiter zu marschieren. Am frühen
Nachmittag erreichten wir den Heimatort meiner Mutter und mieteten
ein möbiliertes Zimmer. Die dritte Klasse absolvierte ich in
dieser zweiklassigen Volksschule, für mich eine Zeit der Freiheit
und der Läuse. Aber es gab Essen in Hülle und Fülle. Am ersten
Sonntag verschlang ich fünf Kalbsschnitzel und wurde nicht krank,
Keine Bomben, viel zu essen und viel Freiheit, denn meine Mutter
ging zu den Bauern aufs Feld arbeiten, um Essen zu bekommen und um
die Essensmarken zu sparen.
Im Juni bekam meine Mutter wieder eine Wohnung in Wien und
es ging zurück, mit der Bahn natürlich, sechs Stunden für den
Rückweg, dreieinhalb Tage für den Hinweg. Aber wie schon Frank
Sinatra sang ...That's life.....M. P., Jahrgang 1936